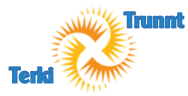Was treibt einen Freiberufler mit 60-Stunden-Woche und Vater einer fünfköpfigen Familie dazu, einen Märchenroman zu schreiben? Rückblickend staune ich selbst, wie sich Zeit und Umstände gefügt haben, damit ich auf 614 A4-Seiten 365.440 Wörter anreihen konnte.
Auslöser waren die Frauen, mit denen mich ein gütiger Herrgott beschenkt hat. Die erste davon, meine Gattin, erklärte mir eines Tages im September 2012, sie wolle kein Brimborium um ihren 50. Geburtstag machen und stattdessen zur 49. Wiederholung ihrer Ankunft auf der Erde einen Brunch mit Freunden abhalten. Dort solle jeder Gast einmal etwas vortragen, ein Gedicht, eine Parodie oder einen Ausschnitt aus einem Buch, das ihm besonders gefällt. Die Idee fand ich originell und kann im Nachgang das ungewöhnliche Format nur loben und zur Nachahmung empfehlen. Es wurde ein fröhliches Zusammensein. Wir haben seinerzeit spontan ein paar Stunden nachgebucht, weil sich keiner recht nach Hause trollen wollte. Vom Essen blieb allerdings eine Menge übrig, obwohl es lecker geschmeckt hatte.
Sechs Wochen später, kurz vor dem Aufbruch zur Feier, musste ich eben „die Welt retten und 587 Mails checken“, saß jedenfalls an meinem Schreibtisch, als mir meine Frau die übliche Erinnerung angedeihen ließ, garniert mit dem Spruch: „Vergiss Deinen Vorlesebeitrag nicht!“
„Mist!“, schoss mir in den Kopf, weil ich diesen Teil glatt vergessen hatte. Zum Glück beschlich mich prompt der erlösende Einfall. Früher hatte ich einmal für die beiden Großen ein Märchen verfasst, was die zwei gelegentlich gern als Gutenachtgeschichte gehört hatten. Schwupps hatte ich die Datei ausgespäht, aufs Papier gedruckt und schloss mich damit getrost der aufbrechenden Familie an.
Wie erwähnt wurde es ein toller Tag. Wir haben uns bei Auszügen aus „Tschick“ (Wolfgang Herrndorf) vor Lachen gebogen, dies und jenes Gedicht wurde rezitiert und mein Akt erzielte den gewünschten Erfolg. Die beiden Halbwüchsigen quittierten die Erinnerung aus ihren Kindheitstagen mit einem Lächeln.
Dann schloss sich der Auftritt des zweiten weiblichen Wesens in meiner Umgebung mit der Initialzündung für Aurelia & Adalwin an. Unsere kleine Tochter, damals fünf Jahre alt, war gerade im Madame-Aussi-Alter, wie wir diese Periode bei unserer Großen in Erinnerung an einen Frankreich-Urlaub getauft hatten, in dem das Phänomen erstmals auftrat und das Kind quasi alles mit „ich auch“ (moi aussi) kommentierte. Natürlich folgte, nachdem ich meinen Part beendet hatte, mit unwiderstehlichem Augenaufschlag (das muss den kleinen Evas in den Genen eingebrannt sein) der Satz: „Papi, ich möchte auch mein Märchen haben!“ Leichtfertig und noch berührt von der guten Stimmung, die sich im Raum ausgebreitet hatte, bejahte ich das Ansinnen: „Klar, Du bekommst Deine Geschichte.“
Tja, so war es. Tatsächlich gaben die Laune einer Fünfjährigen und ein unbedachtes Beruhigungs-Jaja den Startschuss in das Abenteuer, einen Fantasy-Roman zu schreiben, denn kaum ausgesprochen mahnte sich die kleine Elfe schon beim Gutenachtkuss die Zusage ein. Der Rückzug war abgeschnitten. Die Würfel waren gerollt;-).
Am nächsten Wochenende legte ich los. Fantasy-Romane hatte ich früher geliebt, Heldensagen im Dutzend verschlungen, das Ammenrüstzeug aller Herren Länder gelesen und an Fantasie-Mangel wohl nie gelitten, war doch einer meiner Mutter Lieblingsworte für mich „Spinnie-Fix“ gewesen. Angesichts des süßen Blondie mit blauen Augen, für das die Fabel sein sollte, wäre aber sicher jedem noch so minderbemittelten Erzähler etwas zum Äußeren seiner Heldin eingefallen. Dazu begeisterte sich das Kind damals für alles Glitzernde bzw. Geschmeide. Was lag also näher, als Gold, im Periodensystem mit Au von Aurum abgekürzt, zu verweiblichen? Aurelia war geboren, erhielt blonde Haare und tiefblaue Augen. Erst später hat mir das Internet verraten, dass ich nicht der Erste war, der den Zusammenhang zum Lateinischen herstellen konnte.
Nun mal los, wie fängt ein Märchen an? Als erstes wird heutzutage Word gestartet. Ziemlich blöde glotzt einen der weiße Bildschirm an und ist vor allem eins: leer. Was ist der Klassiker? Genau! Es war einmal – und dann?? Klar war, es musste ein Einhorn her. Das Kinderzimmer war seinerzeit voll mit den Fabelwesen ausstaffiert. Und das Böse ist immer ein Drachen. Soweit so gut. Einen Neuaufguss von Brüder Grimm mit anderen Namen empfand ich nichtsdestotrotz als zu einfallslos. Da schob sich das Trauerspiel in mein Bewusstsein – und hier tritt das dritte Frauchen in meinem Nahfeld erstmals ins Spiel ein – das sich jeden Morgen im Bad abspielte. Unter Gezeter der Kleinen versuchte im Auftrag der Mutter die große Tochter Ordnung in das blonde Gewirr zu bringen, was regelmäßig mit Tränen oder Geschrei und Türenknallen endete. Ergo ersann ich eine Handlung, in der Aurelia sich vor dem Spiegel ihre langen Haare kämmte.
Am nächsten Morgen geschah das Wunder. Als ich ins Bad platzte, posierte meine Fünfjährige vor dem Spiegel und bürstete sich mit heiligem Ernst im Gesicht freiwillig und mit eigener Hand die Fitze aus. „Super“, dachte ich bei mir und klopfte mir gedanklich auf die Schulter. „Das klappt prima, darauf kannst du bestimmt noch mehr aufbauen!“ Dem Leser des vierten Kapitels wird im Gasthaus der Verwirrung ein Relikt aus dieser Phase begegnen, als ein besorgter Papa den moralischen Zeigefinger erhob.
Das Schreiben begann mir Spaß zu machen. Blaue Kulleraugen belohnten mich des Abends und spornten mich neu an. Der Hobby-Pädagoge frohlockte zudem über die prächtige Gelegenheit, den Wortschatz des Sprösslings auf diese Weise bereichern zu können. Vorlesen ist mit Sicherheit eine treffliche Art, die Fantasie anzuregen und den Tag zu beschließen. Das ist im Bildungsbürgertum Konsens und bei der dritten Blume, die mir das Leben unverhofft geschenkt hatte, wollte ich keinesfalls wieder derart viel verpassen wie bei den Großen geschehen, bei denen mich Ehrgeiz und vermeintliches Müssen oft in der Ferne weilen ließ.
Einige Wochen schlichen dahin, ich hatte üblicherweise zwei oder drei Seiten Vorsprung, rappelte mich gern in der Frühe auf, um diesen zu gewinnen und sicher wäre ich irgendwann auf die Schlusswendung eingebogen, nachdem Adalwin bei den Turkannen Aurelia zur Flucht verholfen hätte und der Drachen besiegt wurde. Da griff ein zweites Mal mein anderes Töchterlein ins Spiel ein. Mit beängstigender Geschwindigkeit verwandelte sich das Gold- und Musterkind in eine Kratzbürste und verdrückte sich geistiger Weise in ihre eigene Welt der Pubertiere, dem Jungen folgend, der sich bereits eine Weile darin aufhielt. Konsterniert standen wir daneben, fühlten uns macht- und hilflos und außerdem ungerecht behandelt, bildeten wir uns doch ein, als Eltern großzügig und liebevoll zu sein.
Zu der Zeit war mir aufgefallen, wie meine beiden Großen die Eragon-Bücher verschlangen. Mir drängte sich eine grässliche Idee auf: Irgendwann würden die Halbwüchsigen ihrer Wege gehen und vielleicht wäre der Gesprächsfaden nie mehr zu knüpfen, der inzwischen komplett gerissen war. Daher beschloss ich, die Gelegenheit zu nutzen und Botschaften in einem Buch zu verpacken. So reifte mein Entschluss, das Märchen für die Kleine zum Roman auszuweiten. Später würden der Nachwuchs mal lesen können, was uns Eltern bewegt hat und woraus wir unser, von ihnen oft belächeltes Denken und Handeln, bezogen haben. Gedacht, getan.
Meinen Frust über die Metamorphose meiner Goldmarie in eine egozentrierte Rebellin habe ich genauso wie meine Hoffnung, dies würde vorbeifliehen, in eine Mutter-Tochter-Parabel gepackt und justament Aurelia in die Sümpfe der Einsamkeit verfrachtet. Dort befreit sie nach langem Verharren sich selbst und eine verwunschene Prinzessin, nämlich Nastasia.
Woher stammte dieser Name? Einfach erklärt: Nastasia bzw. Nasty hieß der erste Schwarm meines Sohnes, ist eine Halbrussin und wie viele Töchter dieses großen Landes zwar betörend hübsch, aber ebenso der festen Überzeugung, eine Nachkommin der lange verschollenen Romanow-Tochter sein zu müssen (https://de.wikipedia.org/wiki/Anastasia_Nikolajewna_Romanowa). Als ich 1989 für ein halbes Jahr am Leningrader Polytechnikum weilte, habe ich konstatieren müssen, dass St. Petersburg voll von Nastasias ist, auch wenn sie heute meist Olga, Tanja, Zweta oder Lena heißen.
Noch etwas sei an dieser Stelle verraten: Das Mitgefühl ist bei meiner Sechzehnjährigen wieder erwacht und nicht erst, nachdem sie Papas Buch (freiwillig!) gelesen hatte.
Spätestens jetzt soll die Vierte im Bunde erwähnt werden, die für diese Trilogie maßgeblich gewesen ist. Eine meiner Lieblingskundinnen interessierte sich für das Märchen, weil sie eine fast gleichalte Enkelin regelmäßig zu betreuen hatte. Erstmals schmökerte jemand Fremdes in dem Fantasy-Märchen – und war begeistert. Außerdem hatte sie einige Anregungen parat, wie die Aufwertung Adalwins zum gleichwertigen Partner. Bis zum Schluss trug die zitierte Dame als treuester Testleser mit ihrer Sympathie für das Werk und ihrem Lob neben der Geduld meiner Familie wesentlich zum Entstehen des Märchenromans bei.
Später widmeten sich einige andere Kunden/innen und Freunde/innen der Lektüre. All jenen sei an dieser Stelle für die Ermunterung und das freundliche Wort gedankt – siehe auch: Wer will schon Danksagungen lesen. Eines ist sicher: Ohne diese Anerkennung wäre mir bestimmt unterwegs die Lust ausgegangen.